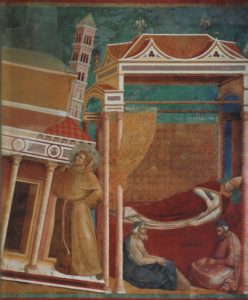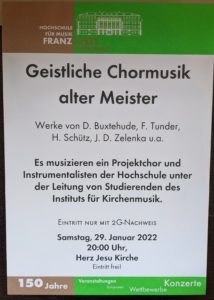Allerhöchste Zeit, die Reihe “PuLa-Reloaded”, die im Advent, zur Weihnachtszeit und dann jetzt, weil, ja, weil soviel zu schreiben war!, etwas zu kurz gekommen ist, wieder aufleben zu lassen! Bloß gut, daß wir auch über den Ablauf des ‘Jubeljahrs’ 🙂 zum 10-jährigen im März hinaus noch jede Menge Stoff haben… 😉
Heute haben wir einen relativ jungen Text von Cornelie für Sie, der sich Ende Juli 2019 schon mit “Zahlen zum Kirchenaustritt” beschäftigte (hier), ein Thema, das ja gerade wieder ungeheuer Konjunktur hat, nach der Veröffentlichung des sog. “Münchner Mißbrauchsgutachtens”.
Zu diesem Gutachten, und dem, was es tatsächlich belegen kann, gibt es viel zu sagen und es wird auch richtigerweise darüber geredet und geschrieben (dazu vielleicht später mehr), aber die Äußerungen, aus dem Raum der Kirche in unserem Bistum, die sind auf jeden Fall ein Thema für PuLa, ebenso, wie das, was medial aus unserem mitteldeutschen und näherhin Thüringer Raum dazu so verlautet.
Beides kommt nun zusammen in einem Radiobeitrag, der am vergangenen Sonntag, 13. Februar 2022, um 8:15 Uhr auf MDR-Kultur lief: „Katholische Kirche: Mitglieder denken an Austritt“. Ein langjähriger Freund hat uns darauf aufmerksam gemacht (Danke!) und gleich auch noch die Audio-Datei besorgt, die wir allerdings leider nicht veröffentlichen dürfen. Aber, wie gesagt, sie liegt uns vor.
In diesem etwa 4 Minuten langen Beitrag verarbeitet Samira Wischerhoff, eine junge Journalistin aus dem MDR-Studio Weimar, erstens Zitate aus einem Interview mit Bischof Neymeyr und hat zweitens nach deren Ende mit Besuchern der Hl. Messe in unserer Pfarrkirche gesprochen (mit einer Besucherin ganz besonders, aber dazu gleich mehr).
Sehr ordentlich gemacht, mit abwechselnden O-Tönen, Soundschnipseln aus dem Hintergrund (Glocken!) und sinnvoll plazierten Teilen des, bzw. der Interviews.
Gerahmt von einer An- und ganz kurzen Abmoderation des Kollegen, der durch die Sendung führte.
Nur, dieser “Rahmen” um den Beitrag, er beinhaltet eben auch das “Framing”: “Will ich eigentlich noch dieser Kirche angehören?, heißt es mit sonorem Tremolo und der im Raum stehende Vorwurf der “Vertuschung” gegenüber Papst Benedikt darf natürlich nicht fehlen, deswegen habe sich der Bischof mit einem Brief an die Angehörigen des Bistums Erfurt gewandt, worauf PuLa ja bereits einen Antwortbrief geschrieben hat (hier).
Bevor wir nun dazu kommen, warum dieser Radiobeitrag aus dem Februar 2022 so gut zu einem Text paßt, der schon gut zweieinhalb Jahre alt ist, aber zwei Bemerkungen am Rande:
Ungefähr zu Minute 2.40 wird eine “Sprecherin der Pfarrei Herz Jesu in Weimar” vorgestellt und ich ‘rieb mir die Ohren’, wenn ich so sagen darf, denn so etwas gibt es natürlich gar nicht. Tatsächlich handelte es sich um die Vorsitzende des “Kirchortrats” Weimar, die da zu Wort kam (womit, darüber will ich schweigen), aber man kann es wohl einer Journalistin von offenbar protestantischer Prägung kaum übelnehmen, daß sie von diesem skurrilen Gremium, noch nichts gehört hat. ‘Da haben Sie nichts verpaßt’, möchte ich hinzufügen. 🙂
Ernster finde ich da schon, was Frau Wischerhoff ab Minute 1.30 berichtet: “Daß Papst Benedikt für sein Verhalten als Münchner Erzbischof inzwischen um Entschuldigung gebeten hat, hält Bischof Neymeyr für ausreichend”. Aha.
Das habe ich nur leider auf der Seite des Bistums nicht finden können, dort steht nach wie vor der “Brief” vom 28. Januar mit dem, wie beileibe nicht nur ich finde, eigentümlichen Zungenschlag. Sicher, es gibt deutsche Bischöfe, die reden auch nachdem alle Fakten auf dem Tisch liegen davon, der Papa em. spiele hier eine “sehr unglückliche Rolle” und verhalte sich “unverantwortlich”, + Gebhard Fürst von Rottenburg-Stuttgart, um genau zu sein, aber das sollte ja nun wahrhaftig kein Maßstab sein, oder? Schade, sehr schade, daß Bischof Neymeyr hier die Chance zu einer öffentlich wahrnehmbaren Selbstkorrektur nicht genutzt hat, aber danke an Frau Wischerhoff und den MDR, die uns diesen Einblick ermöglichen!
Aber wirklich geradezu skurril wird es, wenn man die Reaktionen der “normalen”, namentlich nicht genannten, Meßbesucher mit dem Framing vergleicht, das der Beitrag insgesamt betreibt, denn: Niemand redet davon, auch nur in Erwägung zu ziehen, der Kirche den Rücken zuzukehren!
Sollte man ja auch nicht, wenn man gerade die allerheiligste Eucharistie mitfeiern durfte und vielleicht gerade die Kommunion empfangen hat und damit gerade wieder sozusagen “frisch” zum ‘Leib Christi’ wurde, und der ist nun einmal die Kirche.
Aber wir kennen schon Menschen aus Weimar, die aus der Kirche “ausgetreten” sind, und wir wissen um ihre ganz individuellen und sehr, sehr “ortsnahen” Gründe dafür, von daher, Frau Wischerhoff, sei auch Ihnen dieses Reload zur Lektüre empfohlen:
Gereon Lamers
239. Eine Zahl, die gute Laune macht
Rechenspiele und ein kleiner Erfahrungsbericht
zum Thema Kirchenaustritte
Von der Suggestivkraft hoher Zahlen
„Typisch, daß dir sowas auffällt“, sagt Gereon, als ich über den Zahlenreihen in Fabian Klaus‘ TLZ-Artikel „Eine Zahl, die weh tut“ zum Thema Kirchenaustritte zu stutzen beginne.
Er hat Recht: Es ist typisch. Zahlen mag ich gern. Die fallen mir immer auf und ich kann sie mir gut merken. Und ich weiß, daß man sie gerne nennt, um damit etwas auszusagen. Und daß man dieselben Zahlen auch für ganz andere Aussagen nutzen kann.
Nachdem Fabian Klaus im Kommentar auf S. 1 der Thüringischen Landeszeitung vom 20. Juli 2019 nur die Austritte aus der katholischen Kirche thematisiert hat, suggerieren die Untertitel zweier Artikel auf S. 2 derselben Ausgabe durch ihren unterschiedlichen Referenzpunkt mehr Austritte im katholischen als im evangelischen Bereich: Genannt werden die über 200.000 deutschlandweiten Austritte katholischerseits und die 13.625 Austritte der Protestanten Thüringens.
Einer umfassenderen Auflistung entnimmt man bei den Protestanten ein deutschlandweites Minus von 395.000 Mitgliedern (davon rund 220.000 Austritte), bei den Katholiken entsprechend ein Minus von 309.000 Mitgliedern (davon knapp 216.000 Austritte). Schlimm genug – aber jede Argumentation und jede Suche nach kausalen Zusammenhängen muß im Blick behalten, daß nicht nur der katholischen Kirche die Leute davonlaufen.
Wirklich verwirrt hat mich in der TLZ das Operieren mit Austrittszahlen in Überschrift und Text, mit Mitgliederzahlen hingegen in der Tabelle. Da spricht der Artikel von 1.371 Austritten im Jahr 2014, die Zahlentabelle aber ergibt eine Differenz von lediglich 239 Mitgliedern, die das Bistum im Jahr 2015 weniger verzeichnet als 2014. Daher sind auch hier die genauen Austrittszahlen hilfreich, man findet sie, ergänzt durch die Zahlen zu Gesamtbevölkerung und prozentualem Katholikenanteil in Thüringen, hier.
Dort wird nachvollziehbar, daß Fabian Klaus absolut Recht hat, wenn er die Zahl der Austritte im Jahr 2014 als statistischen Ausreißer beschreibt: Lagen die Austrittszahlen seit 2000 im mittleren dreistelligen Bereich (seit 2015 im hohen dreistelligen Bereich), so sind es 2014 1.371, also π mal Daumen das Doppelte.
Wie kommt in einem solchen Jahr der Schwund von – in diesem Fall kann man ruhig sagen: lediglich – 239 Menschen zustande? Wer gleicht die Differenz von 1.132 Mitgliedern aus – haben wir an den Zahlen aus dem vorigen Jahr (s.o.) doch zudem festgestellt, daß die Zahl der Austritte durch andere Faktoren – vermutlich bspw. den Überschuß der Sterbefälle gegenüber den Taufzahlen – noch einmal deutlich erhöht wird? Im konkreten Fall weist die Statistik für Thüringen im Jahr 2014 etwa 27.000 Sterbefälle aus – bei 7% Katholiken ergibt das eine zu erwartende Zahl verstorbener Mitglieder von immerhin 1.890 Menschen. Zeigt die Zahl von nur 239 weniger Mitgliedern bei 1.371 Austritten und den statistisch zu erwartenden 1.890 Verstorbenen, also bei einem Schwund von rechnerisch 3.261 Menschen, den unerwarteten ‚run‘ auf die Kirche in Gestalt von über 3.000 (Wieder-) Eintritten? Das wäre phänomenal und Bischof Tebartz van Elst wäre in all diesen Diskussionen um überregionale Verantwortung für ein wachsendes Desinteresse an Kirche final aus dem Schneider! Oder gab es eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Taufen? Ebenso unwahrscheinlich, denn die Thüringer Geburtenrate (vgl. o.g. Statistik) summiert für 2014 keineswegs untypisch viele Babies auf.
Was hat das zu bedeuten? Wäre das magische Verhältnis von 3.261 zu 239 Menschen wohl gar ein Ausweis der hohen Relevanz der Zugezogenen für unsere Pfarreien und das Leben in den Gemeinden? Das scheint mir über die Maßen wahrscheinlich und ich möchte die Zahl gerne für diesen Nachweis nutzen. Ich sehe in der 239 daher eine Zahl, die mir ausgesprochen gute Laune macht!
„ … läßt er dann nicht die neunundneunzig auf den Bergen zurück“?
(Mt 18, 12)
Aber übrigens – was sollen die großen Zahlen? Lernen wir nicht im Gleichnis vom verlorenen Schaf, daß es auf jede und jeden Einzelnen von uns ankommt? Und ist es nicht ärgerlich, wie sich die Verantwortlichen zum Verständnis dieser Zahlen – denn bei Kirchenaustritten wird vorsichtshalber nicht nach den Gründen gefragt – nur allzu gerne wohlfeile Antworten zurechtzulegen scheinen?
Deshalb will ich von einigen Einzelfällen berichten, bei denen ich die Gründe der Abkehr von unserer Gemeinde und zum Teil zuletzt auch von der katholischen Kirche kenne.
Mein erstes einschneidendes Erlebnis datiert aus dem Jahr 2008, als eine Bekannte statt Herz Jesu Weimar lieber einer evangelischen Pfarrei im Weimarer Land zugehören und daher austreten wollte. ‚Wollte‘ ist schon falsch, denn sie erzählte mir, daß sie geweint habe, als sie telefonisch die notwendigen Unterlagen in unserem Pfarrbüro beantragte: Ihr war deutlich geworden, daß sie mit dem Austritt einen Teil ihres Lebens abschnitt. Warum unternahm sie den Schritt dennoch? Eine schwere Krankheit von Ehemann und Tochter hatte die Jahre zuvor bestimmt – Jahre, in denen sie sich (obwohl sogar hier einheimisch!) mit ihrer seelischen Belastung in Herz Jesu Weimar nicht aufgefangen, in besagter anderen Pfarrei aber getröstet fühlte. Daher nahm sie in Kauf, daß ihrer Biographie in gewisser Weise Gewalt angetan wurde. Ich erzählte beim Gemeindefest unserem damaligen Ortsgeistlichen davon. „Gehen Sie nochmal hin!“ beschwor ich ihn. „Sie ist noch nicht weg. Sie möchte nicht konvertieren. Sie leidet unter dem Gedanken. Und um ihre drei Kinder geht es doch auch.“ – „Wandernde soll man nicht aufhalten“, antwortete mir der Pfarrer, zog eine launige Schnute und zuckte die Schultern und seine Vertraute, die dabei stand, begann über die Familie der betreffenden Frau herzuziehen.
Das zweite einschneidende Erlebnis ist die Durchsetzung des doppelstündigen Religionsunterrichts für die Weimarer katholischen Grundschüler. Die ist komplett meine Initiative, die ich zwar auf ausdrückliche Bitte des damaligen Pfarrers, zuletzt aber erwiesenermaßen gegen den Widerstand von hiesigem Gemeindereferent und besagtem Pfarrer 2010 erreicht habe. Nun bedeutet ein einstündiger Religionsunterricht nicht zwangsläufig einen Kirchenaustritt. Aber Sorge für die Kinder und den Nachwuchs der Pfarrei sieht dennoch anders aus als eine Intrige gegen die gesetzlich vorgesehene religiöse Unterweisung.
Eine einzige Frau, die ich als Mutter etwa gleichaltriger Kinder aus dem katholischen Kindergarten kenne, hat mir als Grund für ihren Austritt aus der katholischen und Eintritt in die evangelische Kirche (unter Mitnahme ihrer Kinder) den Mißbrauchsskandal von 2010 genannt. 2010 ging das Thema, in Folge der Enthüllungen in der Odenwaldschule, ja schon einmal auch in Bezug auf die katholische Kirche durch die Presse und es widerte sie an. Aber das ist wie gesagt die einzige, die mir diesen Grund genannt hat.
Ein Ehepaar kenne ich, die sind wegen des Osterpfarrbriefs 2012 (vgl. hier und hier) und der darin enthaltenen Verleumdungen gegen uns aus der Kirche ausgetreten. Sie sagten: „Was auch immer geschehen ist, so etwas kann man nicht schreiben.“ Zur Vertreibung weiterer Ehrenamtler, die enttäuscht wieder wegzogen, konvertierten oder sich zunächst einfach von der Pfarrei abkehrten, ist der Text „Ich hatte eine Farm in Afrika“ erhellend.
Der Ehrenamtler, der zweifellos der Gemeinde das größte Geschenk gemacht hat, wurde so buchstäblich krank geärgert, daß seine Kinder sich ebenfalls vollständig von der Kirche abgewendet haben. War die Familie vor 10 Jahren bei den Lektoren, im PGR, als Ministrantinnen engagiert in Ehrenämtern der Gemeinde tätig, so haben sich die beiden jüngsten Kinder zuletzt nicht einmal mehr firmen lassen. Die Jugendlichen sind m.W. noch nicht ausgetreten. Aber ihnen wurde eine Entfremdung von der Kirche aufgezwungen, durch die es zum Austritt dann nur noch den von Pressesprecher Weidemann erwähnten „Tropfen“ braucht, „der das Faß zum Überlaufen bringt.“ Einer der erwähnten Jugendlichen wäre jetzt, 2019, zur Firmung an der Reihe: Die Geschichte ist nicht Vergangenheit. Sie ist – was Menschen beispielsweise im Kirchortrat partout nicht wahrhaben wollen und mich für die Sorge um diese Familie beschimpfen – nach wie vor die Gegenwart unserer Pfarrei.
Sie sehen: Die überwältigende Mehrzahl an Distanzierungen von unserer Pfarrei und/oder der Kirche hing und hängt nicht mit dem Finanzbedarf einzelner Bischöfe zusammen. Sie hing und hängt nicht einmal mit dem Mißbrauchsskandal zusammen. Sie resultiert einzig und allein aus ganz persönlichen Erfahrungen mangelnder Seelsorge im sozialen Nahraum der eigenen Pfarrei. Das vielbeschworene „Ende der Volkskirche“ ist keine Naturkatastrophe. Es ist, wo man es wahrnimmt, ganz überwiegend hausgemacht.
Und Weimar? Das pastorale Konzept „So lange ignorieren und unverschämt behandeln, bis die Ehrenamtlichen freiwillig die Segel streichen oder auch gerne ganz wegbleiben“ ist im September 2015 mit Amtsantritt des neuen Pfarrers durch die Integration derjenigen, derer er zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch habhaft werden konnte (was nicht mehr viele der einst Aktiven waren), abgelöst worden.
Ein Aufatmen ging durch die Pfarrei. Etliche Gruppen firmierten sich in der Hoffnung auf die Einsicht der Verantwortlichen, daß es nicht um den Job eines „Pfarrteams“ geht, sondern um das Leben der Pfarrei. Fehlende Dialogbereitschaft, die Entwicklung der musikalischen Arbeit, aber auch generell der Kinder- und Jugendseelsorge läßt befürchten, daß Grundzüge der alten Verhältnisse seit dem Frühjahr 2016 zurückgekehrt sind.
Sollte dem nicht so sein, sollte man von offizieller Seite nicht zögern, das immer mal wieder explizit zu formulieren und durch die bewußte Förderung der wenigen noch bestehenden Gruppen deutlich zu machen.
Cornelie Becker-Lamers